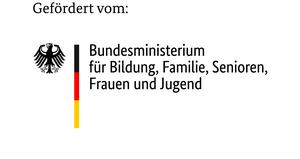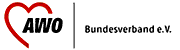Wie und unter welchen Bedingungen eine gewaltbetroffene Person in Deutschland Unterstützung findet, hängt erheblich davon ab, in welcher Lebenssituation sie sich befindet und wo sie lebt. Denn: Jedem Bundesland, jeder Kommune ist nach wie vor selbst überlassen, ob und wieviel man in den Schutz gewaltbetroffener Frauen und Kinder investieren möchte. Die Finanzierung der Hilfeeinrichtungen ist mithin ein riesiger – und löchriger – Flickenteppich: Freiwillige Leistungen hier, Zuschüsse vom Land da, Sozialleistungsansprüche der Frauen dort, dazu Spenden und Eigenmittel. Jede vierte Frau zahlt selbst für den Frauenhausaufenthalt. Das System ist lückenhaft, überlastet und hochkomplex – zu komplex, um Schutz unkompliziert sicherzustellen.
Längst ist klar, dass die Situation nicht den rechtlichen Verpflichtungen genügt, denen die Bundesrepublik u.a. durch die Istanbul-Konvention oder aufgrund der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt unterliegt. Dennoch sind umfassende Maßnahmen bislang ausgeblieben. Das angekündigte Gewalthilfegesetz droht mit dem Ende der Ampel-Koalition zu scheitern.
Der Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit tritt in Deutschland allzu oft zurück hinter Debatten um Haushaltslagen. Doch die Rechnung geht nicht auf: Indem wir umfassende Investitionen in den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt vermeiden, reduzieren wir keine Kosten. Wir verschieben und potenzieren sie nur. Denn: Ja, in Gewaltschutz und Prävention zu investieren, kostet Geld. Aber nicht zu investieren, kostet uns mehr: Gesellschaftlich in Form von Menschenleben. Aber auch finanziell in Form exorbitanter Folgekosten von häuslicher Gewalt, für die Steuerzahler*innen, Kommunen, Länder und Bund wie auch die Betroffenen selbst jedes Jahr teuer bezahlen.
Die zentrale Frage hinter allen Diskussionen um Gewaltstatistiken und Schutzlücken, um fehlende Frauenhausplätze und politische Verantwortung sollte nicht sein, was uns Sicherheit und Selbstbestimmung kosten dürfen – sondern was sie uns wert sein sollten.
Inhalte dieser Ausgabe
Wir schlüsseln die komplexe Finanzierungslandschaft auf. Mit Mitarbeitenden von Frauenhäusern sprechen wir über die ebenso heterogene wie prekäre Realität ihrer Arbeit: Was bedeutet der „Flickenteppich Gewaltschutz“ für sie, aber vor allem für schutzsuchende Frauen und ihre Kinder in der Praxis? Wie treffen Gewalt und finanzielle Benachteiligung von Frauen im Gewaltschutz aufeinander? Und was dürfen wir uns erhoffen vom angekündigten Gewalthilfegesetz?
Zu den Beitragenden dieser Ausgabe gehören
- Prof. Daniela Schweigler
- Hanna Kopahnke, FHK
- Katja Grieger und Katharina Göpner, bff
- Kristin Fischer, BIG Koordinierung
- Dr. Lena Gumnior, djb
und viele weitere.