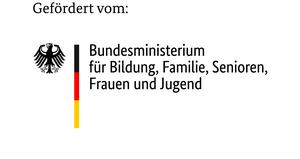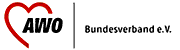Berlin, 16.10.2024. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, den Schutz vor digitaler Gewalt auszubauen – passiert ist bisher wenig. Darauf reagieren jetzt 61 zivilgesellschaftliche Organisationen und Projekte mit einem Forderungspapier. Darin fordern Praktiker*innen aus Frauenhäusern, Beratungsstellen, Dachverbänden und weiteren Frauengewaltschutz-Organisationen die Bundesregierung dazu auf, endlich wirksame Schritte gegen digitale Gewalt zu ergreifen.
Digitale Gewalt: Was ist das Problem?
Mit der Digitalisierung unseres Alltags verlagert sich auch Gewalt in den digitalen Raum. Immer mehr Menschen in Deutschland und weltweit sind betroffen. Zu öffentlichkeitswirksam diskutierten Erscheinungen wie Hate Speech und Cybermobbing treten zahlreiche andere Formen, die medial und politisch weniger Aufmerksamkeit erfahren.
Insbesondere im Kontext von Partnerschaftsgewalt setzt sich analoge Gewalt zunehmend mit digitalen Mitteln fort. Verbreitet sind unter anderem Cyberstalking, Doxing (das unerlaubte Veröffentlichen privater Daten im Netz), unerlaubte Ortung, bildbasierte digitale Gewalt oder Identitäts- und Datendiebstahl.
„Beratungsstellen und Frauenhäuser sind täglich mit digitalen Gewaltformen konfrontiert. Qualifizierte Unterstützung können sie jedoch meist nicht bieten, denn es fehlt an finanziellen und personellen Ressourcen“, erklärt Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin Sibylle Schreiber von Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) „Wenn Gewalttäter Betroffene digital orten und ausspähen, geraten auch Schutzräume mit geheimen Adressen und Mitarbeiter*innen in Gefahr.“
Stillstand im Einsatz gegen digitale Gewalt?
Die Ampelkoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, den Schutz vor digitaler Gewalt auszubauen und zwei Gesetzesvorhaben dazu auf den Weg gebracht. Umgesetzt wurden die Pläne bislang nicht.
„Das Hilfesystem ist stark unterfinanziert. Gleichzeitig nehmen die Fälle digitaler Gewalt konstant zu. Diese Schieflage kann für Betroffene von digitaler Gewalt, die Unterstützung suchen, gefährlich bis lebensbedrohend sein. Es ist höchste Zeit, dass Bund und Länder digitale Gewalt ernst nehmen und die Finanzierung des Hilfesystems verbessern, damit Betroffene gut und sicher beraten werden können“,
erklärt Ophélie Ivombo , Referentin für Digitale Gewalt bei FHK.
Forderungen an Bundestagsabgeordnete übergeben
61 Organisationen und Projekte sowie 77 im Themenfeld engagierte Expert*innen haben deshalb das Papier „Digitale Gewalt ernst nehmen!“ unterzeichnet. Am 16. Oktober übergaben Vertreter*innen der Zivilgesellschaft das Papier im Rahmen eines Parlamentarischen Frühstücks an Abgeordnete der Ampelkoalition.
Das vollständige Forderungspapier steht unten zum Download zur Verfügung.
Die wichtigsten Forderungen im Überblick
Die wichtigsten Forderungen an Bundestag und Bundesregierung sind:
1. Betroffenenzentriertes Vorgehen
Die Bedarfe der Betroffenen müssen bei der Bekämpfung digitaler Gewalt im Vordergrund stehen. Dies stellt Anforderungen an den Ausbau der Beratungsstrukturen, an Polizei und Justiz.
2. Bedarfsgerechte Finanzierung des Unterstützungssystems
Eine langfristige und angemessene Finanzierung von Beratungs- und Schutzeinrichtungen ist notwendig, um die Anforderungen im Zusammenhang mit digitaler Gewalt zu bewältigen.
3. Prävention gegen und Sensibilisierung für digitale Gewalt
Digitale Gewalt muss als solche erkannt werden und bekannt sein, um gemeinsam dagegen vorzugehen.
Die Forderungen entstanden 2024 unter Federführung des Projekts Ein Team gegen digitale Gewalt (Institut für Technik und Journalismus e.V.) und Robert Bosch Stiftung in engem Austausch mit Berater*innen aus Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern in acht Bundesländern und den Dachverbänden Frauenhauskoordinierung e.V. und bffe.V.