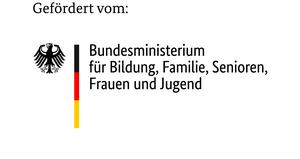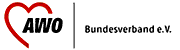Update vom 19. November 2025:
Die Bundesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch, 19. November 2025, einen Gesetzentwurf zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz beschlossen. Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) hat zum sogenannten Referentenentwurf des Gesetzes von Ende August 2025, zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, eine Stellungnahme geschrieben.
Unsere Kritik, dass die Fußfessel nicht gegen den Willen der Betroffenen angeordnet werden kann, wurde gehört und in den jetzigen Gesetzentwurf entsprechend aufgenommen. Auch wurde die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung mit der Teilnahme an einem Täterkurs verknüpft und mit einer sogenannten Gewaltpräventionsberatung ergänzt.
Das Umgangsrecht wird laut dem nun vorliegenden Gesetzentwurf mit den Maßnahmen von Kinderschutzfällen synchronisiert.
Dieser Artikel wurde erstmalig am 17. September veröffentlicht. Er ist ein Artikel zum Thema Gewaltschutz und (Hoch-)Risiko-Management aus unserer diesjährigen Fachinformation.
Risikomanagement passiert vor dem Fall
Vor dem Hintergrund der Anforderungen an den Staat, Gewaltschutz zu gewähren und Femizide zu verhindern, finden sich verschiedene Schlagworte wie „Fußfessel“ und soziale Trainingskurse in der fachlichen und politischen Debatte. Diese Einzelelemente werden hervorgehoben und als Gamechanger angepriesen. Sie müssen jedoch eingebettet sein in ein Risikomanagement, da sie isoliert und ohne eine entsprechende Analyse nicht wirksam eingesetzt werden können.
Die Einschätzung der Gefahrenlage ist Voraussetzung und nicht Folge verschiedener neu aufgerufener Instrumente. Zu dem sehr symbolträchtigen Instrument der Fußfessel liegt seit Ende August der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz vor.
Schritt für Schritt – mit einer Fußfessel durch Deutschland?
Bereits im Sommer 2024 entbrannte eine Debatte zwischen dem Innen- und dem Justizministerium des Bundes. Nach dem Vorschlag des damals SPD-geführten Innenministeriums, bundesweit eine elektronische Aufenthaltsüberwachung (so der gesetzestechnische Begriff für „Fußfessel“) einzuführen, konterte das FDP-geführte Justizressort, dass dies eine polizei- und ordnungsrechtliche Maßnahme und daher Ländersache sei.
Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung[1] soll eine „bundeseinheitliche Rechtsgrundlage(n) im Gewaltschutzgesetz für die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel“ geschaffen werden. Der Blick ins Gesetz zeigt, dass grundsätzlich ein solch freiheitsentziehendes Instrument bereits jetzt schon möglich ist – sei es, um präventiv eine*n Gefährder*in von Straftaten abzuhalten, oder um als strafrechtliches Mittel der Führungsaufsicht (§ 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 StGB) Rückfällen vorzubeugen.
Bisher geht es dabei um Täter*innen extremistischer Straftaten oder Sexualstraftäter*innen. In den Polizeigesetzen von bereits acht Bundesländern, z.B. in § 34c des Polizeigesetzes von Nordrhein-Westfalen, in § 31a des hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und seit Frühjahr 2025 in § 201 c des Landesverwaltungsgesetzes Schleswig-Holsteins[2], gibt es entsprechende Regelungen für Fälle häuslicher und sexualisierter Gewalt.
Das thüringische Polizeiaufgabengesetz soll ebenfalls aktualisiert werden. Dabei handelt es sich um meist zeitlich beschränkte Maßnahmen (drei bis vier Monate), die angesichts des hohen Rechtsguts der persönlichen Freiheit einer besonderen Prüfung und eines amtsgerichtlichen Richtervorbehalts unterliegen.
Überwacht wird die Einhaltung der Aufenthaltszonen über die „Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder“ (GÜL) in Hessen. Diese wurde durch einen Staatsvertrag zwischen Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eingerichtet, dem alle übrigen Bundesländer beigetreten sind. Tatsächlich sind in Deutschland seit dem ersten Modellversuch im Jahr 2000 etwa 2.300 Fußfesseln, davon etwa 200 im Jahr 2024, angelegt worden – in erster Linie Anwendungsfälle der Führungsaufsicht nach einschlägigen Straftaten.
Diese wird angeordnet, wenn ein verurteilter Straftäter nach der Haftentlassung weiterer Kontrolle und Unterstützung bei der Resozialisierung bedarf. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr hohe Anforderungen an die Rechts- und Verfassungsmäßigkeit einer solchen Maßnahme gestellt, sie aber grundsätzlich für verfassungskonform erklärt. [4] Über eine präventiv eingesetzte Fußfessel nach den nun im Raum stehenden Modellen ist dabei jedoch nicht entschieden worden.
Spanien als Vorbild
Im Januar 2025 wurde in Sachsen die erste „Fußfessel nach spanischem Modell“ eingesetzt5 . Auch in diesem Fall wurde die Maßnahme angeordnet, nachdem bereits eine Haftstrafe verbüßt worden war. Die Rechtspolitik geht davon aus, dass die jetzigen Instrumente des Gewaltschutzes nicht ausreichen, um Femizide zu verhindern. Dem soll nun durch die Änderung des Gewaltschutzgesetzes begegnet werden, indem zivilrechtlich das Tragen einer Fußfessel angeordnet werden kann.
Die Begründung liegt in der sachlichen Nähe zu Schutzanordnungen wie Näherungs- und Betretungsverboten, deren Einhaltung mit der Fußfessel besser kontrolliert und Verstöße konsequenter sanktioniert werden können. Mit den inzwischen sehr drängenden Vorschlägen zur Einführung einer Fußfessel (Koalitionsvertrag Ankündigungen in Bundesrat[6] und Beschlussfassung der Innenministerkonferenz [7]) wird regelmäßig auf das Erfolgsmodell aus Spanien verwiesen.
Dessen Verfassungsgesetz (Ley Orgánica 1/2004) stellt ein umfassendes Schutzpaket bei geschlechtsspezifischer Gewalt dar. Bestandteile sind Prävention, Opferschutz, konsequente Strafverfolgung und begleitende Maßnahmen für Betroffene am Wohnungs- und Arbeitsmarkt.
Der Einsatz der elektronischen Fußfessel für den Täter und die gleichzeitige Ausstattung der betroffenen Person mit einem GPS-Empfänger (bilaterale Technologie) erfolgt nach einer gerichtlichen Entscheidung eines auf häusliche Gewalt spezialisierten Gerichts.
Dessen Entscheidung basiert auf Rückmeldungen der Polizei und Sozialarbeiter*innen sowie der Einschätzung der individuellen Betroffenensituation. Das Gericht prüft auch, ob der Täter Waffen besitzt oder inhaftiert werden sollte. [8]
Dabei kommt ein spezielles webbasiertes Risikobewertungssystem für geschlechtsspezifische Gewalt (VioGén) zum Einsatz. Dieses beleuchtet umfassend zurückliegende und aktuelle Gewaltvorfälle unter Zuhilfenahme einer nationalen überörtlichen Datenbank. Auch wird die familiäre, soziale, ökonomische und psychische Situation von Täter und betroffener Person einbezogen. Danach erfolgt eine Einstufung in eines von fünf Risikolevels.
Je nach ermittelter Risikostufe ordnet das Gericht Maßnahmen an. Bei Frauen mit niedrigem Risiko kann der Schutz beispielsweise darin bestehen, sie regelmäßig anzurufen und sie nach ihrer Situation zu fragen. Dabei wird die jeweilige Risikobewertung aktualisiert. Bei einem hohen Risiko legt das System beispielsweise Patrouillen um ihren Wohn- oder Arbeitsort fest.
Bei der höchsten Stufe werden elektronische Überwachungsgeräte angeordnet. Ein privater Dienstleister versorgt die Beteiligten mit den Geräten. Zwischen Gericht und Technikanbieter agiert COMETA, eine multiprofessionell besetzte Institution, die ganzjährig und 24 Stunden am Tag erreichbar ist.
Sie beobachtet sämtliche Fußfesselpaarungen, löst Alarm beim Täter und der gewaltbetroffenen Person aus und informiert bei fehlender Reaktion die nächste Polizeistation. Sie unterhält neben der Überwachung auch die ständige Kommunikation zwischen Gericht, Strafbehörden und der statistischen Erfassung.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz ist es Spanien gelungen, dass die Zahl der Femizide erheblich abgenommen hat (der Anteil der Getöteten, die eine Schutzanordnung hatten, ist von 18 Prozent in 2010 auf 7 Prozent in 2015 gesunken) [9].
Erfolgsbilanz und Übertragbarkeit
Kritisch wird jedoch von den spanischen Frauenunterstützungseinrichtungen bemerkt, dass es dennoch weiterhin Morde an Frauen gibt. Als Ursache wird auf eine fehlerhafte Risikoeinschätzung verwiesen und darauf, dass nur etwa 25 Prozent der Betroffenen im Vorfeld Kontakt zur Polizei, also überhaupt erst die Chance auf eine entsprechende Wahrnehmung und Versorgung hatten.
Ähnliche Erkenntnisse sind auch für Deutschland anzunehmen. Im Vorgriff auf eine zu erwartende Studie zu Femiziden der Universität Tübingen, [10] wurde bereits deutlich, dass „nur“ 10 Prozent der untersuchten Fälle für die Versorgung mit einer Fußfessel geeignet gewesen wären.
Gleichzeitig waren etwa 40 Prozent der betroffenen Frauen vorher nicht durch Polizeieinsätze oder Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz in den Blick staatlichen Schutzes genommen worden. Das bedeutet, dass viele Betroffene im Hilfesystem nicht angebunden sind oder die Warnsignale entweder nicht deutlich waren oder nicht wahrgenommen wurden.
Es bleibt also die Sorge, dass ein erheblicher Prozentsatz gewaltbetroffener Frauen trotz Einführung einer Fußfessel weiterhin der Gefahr einer Tötung ausgesetzt bleibt. Und dies auch, obwohl zu einem hohen Anteil der Fälle entsprechende Ankündigungen durch die Täter gemacht wurden. Die Aussage „ich bringe dich um“ ist also durchaus ernst zu nehmen. Die zweithäufigste Ankündigung dieser Art erfolgte gegenüber den Kindern. Es sind also andere Frühwarnsysteme nötig bzw. Signale müssen ernster genommen werden.
Gewaltschutzgesetz – nicht der richtige Ort für die Fußfessel
Wenn die anzuordnende Fußfessel im Gewaltschutzgesetz verankert wird, könnte sie gerade die besonders gefährdeten Frauen nicht erreichen. Denn laut Frauenhausstatistik [11] stellen nur etwa 12 Prozent der im Frauenhaus lebenden Frauen einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz auf Schutzanordnungen. Auch berichteten die 41 Prozent der Frauen, in deren Fällen es zu einem Polizeieinsatz gekommen war, dass in der Folge des Polizeieinsatzes nur in acht Prozent der Fälle ein Platzverweis durch die Polizei ausgesprochen wurde.
In Gewahrsam genommen wurden gewaltausübende Personen sogar nur in zwei Prozent der Fälle und Gefährderansprachen wurden in neun Prozent der Fälle durchgeführt. Obwohl in den Polizeigesetzen der Länder entsprechende Maßnahmen wie Wegweisungen, Betretungsverbote oder Aufenthaltsverbote – wie bereits erwähnt durch sogar elektronische Aufenthaltsüberwachung – bei häuslicher Gewalt vorgesehen sind, zeigt die Statistik, dass sich nur ein geringer Anteil der polizeilichen Maßnahmen an die Täter richtet. Eher kommen die gewaltbetroffenen Frauen (20 Prozent) durch polizeiliche Vermittlung ins Frauenhaus.