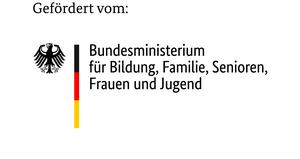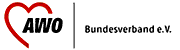Berlin, 12. Juni 2025. Anlässlich der 223. Innenministerkonferenz in Bremerhaven begrüßt Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK), dass Femizide endlich als sicherheitspolitisches Problem erkannt werden.
Gleichzeitig kritisiert FHK die Verknüpfung von Gewalt gegen Frauen mit Migrationsdiskursen und warnt vor einseitigen Lösungsansätzen wie elektronischen Fußfesseln ohne begleitende Strukturen.
Die Zahlen sind erschreckend: 2023 wurden in Deutschland 360 Frauen getötet und 578 Tötungsversuche an Frauen verübt.
„Es ist längst überfällig, dass die Innenministerkonferenz Femizide als das benennt, was sie sind: geschlechtsspezifische Gewalt mit strukturellen Ursachen“, erklärt Sibylle Schreiber, Geschäftsführerin von FHK.
Die Anerkennung als grundlegendes sicherheitspolitisches Thema ist ein wichtiger Schritt, um endlich umfassende Präventions- und Schutzmaßnahmen zu entwickeln.
Elektronische Fußfesseln: Kein Allheilmittel ohne begleitende Strukturen
Als Lösungsansatz setzt die Innenministerkonferenz auf elektronische Fußfesseln. FHK sieht diesen Ansatz kritisch:
„Elektronische Überwachung kann nur ein Baustein in einem umfassenden Schutzkonzept sein“, betont Dr. Katharina van Elten, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von FHK. „Ohne flächendeckende Risikoanalysen und multidisziplinäre Fallkonferenzen, kontinuierliche Begleitung der gewaltbetroffenen Frauen, geschulte Fachkräfte in Polizei und Justiz wird dieser Ansatz alleine nicht greifen.“
Der Vorschlag, die elektronische Überwachung im Gewaltschutzgesetz zu verorten, stellt eine hohe rechtliche Hürde dar, und die verfassungsrechtlichen Anforderungen sind komplex.
Zudem stellen viele Frauen, die Schutz in Frauenhäusern suchen, keine Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz – aus Angst vor Kosten, mangelnder Wirksamkeit oder Retraumatisierung.
Migrationsdebatte lenkt von strukturellen Problemen ab
Problematisch sieht FHK die Verknüpfung von Gewalt gegen Frauen mit Migrationsdiskursen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer betonte zwar zu Recht, dass Deutschland ein „Femizid-Problem“ habe, verwies aber gleichzeitig darauf, dass „vor allem junge Männer“ zu uns kämen und dies Auswirkungen auf die innere Sicherheit habe.
Solche Aussagen lenken von den eigentlichen Ursachen geschlechtsspezifischer Gewalt ab.
Laut dem Bundeslagebild Geschlechtsspezifische Gewalt haben 73,8 Prozent der Tatverdächtigen bei häuslicher Gewalt die deutsche Staatsangehörigkeit.
„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Gewalt gegen Frauen ist kein ,importiertes‘ Problem. Die Täter stammen aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Eine solche Stigmatisierung verstellt den Blick auf die eigentlichen Ursachen, die in ungleichen Machtverhältnissen liegen, und verhindert wirksame Prävention“, stellt Sibylle Schreiber klar. „Wer Femizide mit Migration verknüpft, sucht Sündenböcke statt wirksame Präventionsansätze.“
Frauen mit Migrationserfahrung sind besonders schutzbedürftig
Die Statistiken zeigen vielmehr, dass Frauen mit Migrationserfahrung überproportional von Gewalt betroffen sind: Während 33 Prozent der weiblichen Betroffenen von Partnerschaftsgewalt eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit haben, machen sie nur etwa 12 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.
Auch ein großer Teil der Frauen, die in Frauenhäusern Schutz suchen, hat eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit – 63 Prozent im Jahr 2023. Diese hohe Zahl verweist nicht auf die Nationalität der Täter, sondern vielmehr auf den Mangel an Alternativen für betroffene Frauen, etwa an finanziellen, rechtlichen oder familiären Ressourcen, um für sich und ihre Kinder andere Wege aus der Gewalt zu finden.
Die überproportionale Präsenz von Frauen mit Migrationshintergrund in Frauenhäusern ist somit ebenfalls kein Beleg für ein „importiertes Problem“, sondern ein Hinweis auf ihre besondere Schutzbedürftigkeit und auf strukturelle Barrieren, die ihre Ausstiegsmöglichkeiten erschweren.
„Diese Frauen fliehen oft vor struktureller geschlechtsspezifischer Gewalt, sind in Geflüchtetenunterkünften zusätzlichen Gefahren ausgesetzt und geraten aufgrund unsicherer Aufenthaltstitel in gefährliche Abhängigkeitsverhältnisse", erläutert Dr. Katharina van Elten weiter. „Die Istanbul-Konvention verpflichtet uns dazu, gerade diese Frauen zu schützen – anstatt sie durch eine restriktive Migrationspolitik zusätzlich zu gefährden.“
FHK fordert umfassende Strategie statt Symbolpolitik
Statt auf Einzelmaßnahmen zu setzen, braucht Deutschland eine umfassende Strategie gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Es braucht:
- Eine gesamtgesellschaftliche Präventionsstrategie gegen häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt, die auf koordiniertem Handeln im Zusammenspiel mit Kommunen, Ländern und dem Bund basiert
- Eine bedarfsgerechte Finanzierung und den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern
- Flächendeckende Risikoanalysen und ein interdisziplinäres Hochrisikomanagement zur Verhinderung weiterer Gewalteskalation zum Schutz der betroffenen Frauen und ihrer Kinder in allen Bundesländern
- Verpflichtende Fortbildungen für Polizei, Justiz und alle beteiligten Professionen zu Gewaltdynamiken
- Täterarbeit als verpflichtender Baustein in allen Gewaltschutzverfahren sowie in Sorge- und Umgangsverfahren bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt
- Schutz für alle gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder– unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus