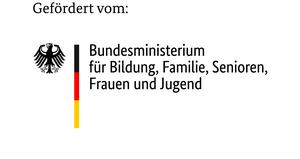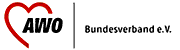Im Rahmen einer Fachtagung hat das BMBFSFJ zentrale Befunde der bundesweiten Studie „Bedarfsanalyse zur Prävention geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt“ vorgestellt. Über die Hälfte der sechzig-seitigen Kurzfassung der Bedarfsanalyse umfassen 47 Handlungsempfehlungen, welche Erwartungen seitens der Fachpraxis an die Politik sowie konkrete Handlungsempfehlungen im Themenfeld Prävention zusammenfassen.
Die Studie, an der u.a. Forscher*innen von SoFFI, SOCLES und dem DJI mitgewirkt haben, arbeitete methodisch mit einem explorativen Ansatz und führte Online-Umfragen sowie qualitative Expert*innenbefragungen durch und analysierte Kampagnen und Aktionspläne sowie relevante Forschungsliteratur. Ein weiterer Bestandteil waren eine Bestandserhebung schulischer Prävention und kommunaler ortsbezogener sektorenübergreifender Präventionsansätze.
Die Studie betont insbesondere durch die Auswertung internationaler Meta-Analysen, den erwiesenen Nutzen der Beratung gewaltbetroffener Frauen als auch der Täterarbeit sowie die Wirksamkeit von Präventionsprogrammen zur Verringerung geschlechtsspezifischer Gewalt. Als Schlussfolgerung wurde formuliert, dass erfolgreiche Prävention Strukturen, Strategie und Koordinierung mit verlässlichen Ressourcen braucht. Prävention von Gewalt ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit!
Zentrale Befunde – kaum systematische und nachhaltige Prävention vorhanden
Insgesamt besteht eine bundesweit heterogene und strukturell fragmentierte Präventionslandschaft. Evaluationslücken und Ressourcenengpässe erschweren eine evidenzbasierte Weiterentwicklung. Es wurden bundesweit 275 personenbezogene Präventionsangebote ausgewertet, wobei überregionale Programmansätze, jenseits von Täterarbeit, kaum existieren. Zur sektorenübergreifenden lokalen Kooperation sind als Vernetzungsform Runde Tische am verbreitetsten (85% der Kommunen), Interventionsprojekte und interdisziplinäre Fallkonferenzen hingegen sind bis dato weniger verbreitet. Nur in einem Drittel der Kommunen (27,3%) sind Präventionsstrategien vorhanden, im Sinne von koordinierten Maßnahmen mehrerer Akteure.
Beleuchtet wurden Angebote zu Fortbildung für unterschiedliche Berufsgruppen und spezielle zielgruppengerichtete Programme. Die Ergebnisse bewegten sich zwischen einigen zufriedenstellenden Angeboten aber doch deutlichen Defiziten bei der Verteilung der Angebote im gesamten Bundesgebiet sowie einem großen Stadt-Land-Gefälle. Für einige Zielgruppen, die ein hohes Risiko mitbringen, geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt zu erleben, existieren aber laut der Studie kaum Präventionsangebote.
Insbesondere in ländlichen Kreisen fehlt es an schriftlichen Kooperationsvereinbarungen sowie strukturierten Fallkonferenzen. Laut Rückmeldung aus den Bereichen Polizei und Justiz sei hier jedoch bereits ein hoher Grad an Vernetzung und Kooperation etabliert (95,6 % und 89,7%).
Widersprüchlich erschienen FHK die Rückmeldungen zu Maßnahmen des Risikomanagements und Fallkonferenzen im Bereich der Polizei und Justiz. Es wurde in der Studie angegeben, dass diese bereits vielfach etabliert seien, andererseits wurde von dem Forscher*innenteam die flächendeckende Implementierung dieser Instrumente im Sinne der Istanbul-Konvention (Art. 51) empfohlen. Fraglich bleibt inwieweit die positiven Befunde mit dem Befragungssetting zusammenhingen.
Identifizierte Präventionslücken schließen
Präventionslücken beziehen sich insbesondere auf vulnerable Gruppen: LGBTQIA-Personen, Frauen mit Fluchterfahrungen, Frauen mit Behinderungen sowie primärpräventive Angebote für Männer und Jungen. Es existieren wenige Angebote bei digitaler Gewalt, es fehlen mehrsprachige Beratungsangebote im ländlichen Raum und es mangelt an differenzierten Angeboten.
Aus Sicht der Forscher*innen mangelt es insbesondere an Präventionsangeboten an Schulen, Peer-orientierten und beziehungsorientierte Angebote für Jugendliche sowie an Angeboten für mitbetroffene Kinder und Jugendliche.
Priorisierte Zielgruppe von Prävention: Kinder & Jugendliche
Bei der Frage nach Priorisierung wurden Kinder und Jugendliche (73%) als wichtigste Zielgruppe benannt. Diese sollten auch als Primärzielgruppe von Öffentlichkeitsarbeit verstärkt und vor allem digital in den Blick genommen werden. Das Modellprojekt aus dem Aktionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ (2019-2022) von FHK sowie unser Fachkräfteportal wurden hier als zentrale bundesweite Ressource für Präventionsarbeit pädagogischer Fachkräfte genannt.
Deutschland nutzt international erprobte Präventionsmaßnahmen im schulischen Bereich (z.B. Teen-Dating-Violence oder sogenannte Bystander-Programme) bisher nicht und trotz der langjährigen Forderung nach spezifischer Prävention im Kontext Schule und deren Verankerung in Bildungsplänen, wird diese mehrheitlich nicht umgesetzt.
Präventionsstrategie entwickeln & implementieren?
Bei der Befragung der Praxis wurde deutlich, dass das Spektrum von Prävention weitreichender sein müsste. Nicht nur einzelne Maßnahmen sind erforderlich, sondern auch grundsätzliche Ansätze wie Gleichstellung der Geschlechter und gleichwertige Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet sowie eine ressort- und bereichsübergreifende Koordination und Qualitätsentwicklung. Die Bedarfserhebung benennt vielfältige Lücken, Probleme und Herausforderungen und gibt wertvolle und differenzierte Empfehlungen.
Inwiefern die Ergebnisse in zukünftige Maßnahmen der Länder, z.B. im Zusammenhang mit der anstehenden Umsetzung des Gewalthilfegesetzes, das ausdrücklich zu präventiven Maßnahmen aufruft (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GewHG), führen wird, bleibt derzeit abzuwarten. Der neue Zuschnitt des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) bietet jedoch in dieser Legislaturperiode eine einmalige Chance, Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen durch ein übergeordnetes strategisches Handeln vor allem bei jungen Menschen bundesweit (weiter)zuentwickeln.