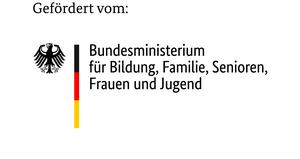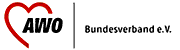Ende 2024 hat die Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt des Deutschen Instituts für Menschenrechte (im Folgenden: BgG) ihren ersten „Monitor Gewalt gegen Frauen“[1] (Berichtszeitraum: 2020 bis 2022) vorgelegt. Mit dem in der Langfassung über 400 Seiten starken Dokument kommt die BgG der ihr von der Bundesregierung übertragenen Aufgabe nach, über den Stand der Umsetzung der Istanbul-Konvention[2] (im Folgenden: IK) zu berichten. Zu diesem Zweck hat die BgG eine der bislang umfangreichsten Datensammlungen zu geschlechtsbezogener Gewalt[3] in Deutschland zusammengetragen. Zusätzlich wurden Gesetzgebung und Rechtsprechung kritisch analysiert. Kapitel 5 des Monitors ist dem Thema Femizide gewidmet. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob der Gewaltschutz in Deutschland den Vorgaben der IK (Art. 51 ff.) entspricht.
Der vorliegende Beitrag liefert eine Zusammenfassung und kritische Einordnung dieser Kapitel, wobei auch Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt „Femizide in Deutschland“[4] eingeflossen sind.
Femizide
Kapitel 5 enthält eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen und politischen Debatte zu Femiziden in Deutschland. Dabei gelingt der BgG ein fundierter Überblick über die einschlägige, deutschsprachige Literatur, die ihrerseits der internationalen Wissensproduktion etwas hinterherhinkt und stark juristisch geprägt ist. Dementsprechend nehmen strafrechtliche Ausführungen den größten Teil des Kapitels ein.
Zu Beginn stellt die BgG klar, dass die IK uneingeschränkt auf Femizide als Form geschlechtsbezogener, körperlicher Gewalt (Art. 35 IK) anwendbar ist, auch wenn der Begriff, der bis vor wenigen Jahren in Deutschland und Europa weitgehend unbekannt war, in dem völkerrechtlichen Vertrag keine Erwähnung findet.
Im Anschluss geht die BgG auf die Frage ein, wie Femizide zu definieren sind. An mehreren Stellen findet sich der Hinweis, dass es bislang keine „allgemeingültige Definition“ (253[5]) für Femizide gebe. Um etwas Klarheit zu schaffen, wird knapp die Begriffsgeschichte nachgezeichnet. Die heutigen Verwendungen des Begriffs schließen an die Arbeit von Diana Russell an, die den Begriff in den 1970er Jahren im Kontext der sog. zweiten Frauenbewegung prägte. Auch die Adaptionen in Lateinamerika (ab den 1990er Jahren, Stichwort: Feminizide) und durch verschiedene internationale Organisationen (ab den 2000er Jahren, UNODC/UNWOMEN; WHO) werden grob skizziert.
Der Bericht versucht sich nicht an einer „allgemeingültigen Definition“, sondern geht dann dazu über, Erscheinungsformen des Gewaltphänomens Femizide aufzuzählen. Diese Auflistung bleibt leider kontextlos, da sehr allgemeine Formulierungen wie „Tötungen von indigenen Frauen“ (256) angeführt werden. Zur Begriffsklärung tragen diese Beispiele, die für fachfremde Leser*innen willkürlich erscheinen müssen, wenig bei. Etwas widersprüchlich mutet vor diesem Hintergrund der Hinweis an, dass Femizide unbedingt als solche benannt werden müssten, obwohl die BgG weitgehend offenlässt und an manchen Textstellen selbst ein wenig ratlos wirkt, anhand welcher Kriterien dies konkret geschehen soll.
Anders als der Bericht teils impliziert, gibt es durchaus einen Grundkonsens, was unter dem Begriff Femizid zu verstehen ist: nämlich „die vorsätzliche Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres (zugeschriebenen) Geschlechts“ (258), wie die BgG am Ende der Begriffsdiskussion selbst resümiert.[6]
Die zentrale Problematik liegt unseres Erachtens in der Operationalisierung dieser Definition bzw. genauer des Bezugs zum Opfergeschlecht („aufgrund ihres Geschlechts“). Wie also lässt sich der Geschlechtsbezug empirisch messen?
In der Literatur lassen sich zwei Ansätze unterscheiden, die häufig verschwimmen[7] und sich auch in der Definition der IK für geschlechtsbezogene Gewalt (vgl. Art. 3 lit. d IK) widerspiegeln: Einerseits wird auf die Tatmotivation („weil sie eine Frau ist“), andererseits auf die strukturelle Diskriminierung von Frauen abgestellt, die vereinfacht gesagt Frauen für bestimmte Formen von Gewalt vulnerabler macht, ohne dass sich dies immer in der Tatmotivation dokumentieren muss. Wenig nachvollziehbar ist, dass die BgG in einer Fußnote darauf hinweist, dass diese zweite, strukturelle Ebene, die in der IK durch die „unverhältnismäßig starke“ bzw. überproportionale Betroffenheit erfasst wird (vgl. Art. 3 lit. d Var. 2 IK), bei Femiziden „eigentlich nicht von Bedeutung“ (Fn. 797) sei. Denn gerade die überproportionale Gewaltbetroffenheit von weiblichen Personen in bestimmten Kontexten (namentlich im Rahmen von heterosexuellen Paarbeziehungen und im familiären Kontext) ist ein bedeutender empirischer Indikator für den Zusammenhang zwischen der strukturellen Diskriminierung von „Weiblichkeit“ und Tötungsdelikten zulasten von Frauen.
Die BgG stützt sich auf eine Operationalisierung, die – einem gewissen Alltagsverständnis folgend – an die Motivation der Tatpersonen anknüpft. Femizide rücken damit in die Nähe sogenannter Hass- bzw. Vorurteilskriminalität. Was „Motivation“ konkret bedeutet, lässt die BgG jedoch offen. Auch wie die „geschlechtsbezogene Motivation“ in Statistiken gemessen werden soll, wie es der BgG für die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) vorschwebt, oder im Strafverfahren nachgewiesen werden kann, wird nicht näher erläutert. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist daran zu erinnern, dass subjektive Gründe für eine Handlung von außen schwer einzuschätzen sind. Die Suche nach „dem Motiv“ ist nicht nur aus diesem Grund stark von Zuschreibungs- und Framingprozessen geprägt. Die Gefahr, ebenjene Motive vorzufinden, die man aufgrund der eigenen Annahmen für plausibel hält, ist groß. Das geht im Alltagsverständnis von Kriminalität und im öffentlichen Diskurs um Femizide oft unter. Das heißt jedoch nicht, dass Motive kriminologisch irrelevant wären oder eine Motivzuschreibung nie gelingen könnte. Um sich den Hintergründen von einzelnen Tötungsdelikten anzunähern, ist allerdings eine sorgfältige, qualitative Kontextanalyse notwendig, die die Motivation in das konkrete Geschehen einbettet. Im Rahmen kriminalstatistischer Erhebungen, die eine enorme Komplexitätsreduktion erfordern, ist das kaum zu leisten.
Zu Recht wird allerdings betont, dass nicht nur Taten aus „reinem Frauenhass“ als Femizide begriffen werden sollten, sondern alle Tötungen, die „letztlich auf der Vorstellung der Ungleichwertigkeit des weiblichen Geschlechts“ basieren (256). Alles andere würde den Anwendungsbereich des Begriffs auf Sonderfälle beschränken. So verstanden sei eine geschlechtsbezogene Tatmotivation vor allem gegeben, so die BgG, wenn Frauen für Verstöße gegen sexistische Rollenerwartungen sanktioniert werden (z. B. bei Trennungstötungen oder ehrbezogenen Tötungsdelikten).
Die BgG gibt zu bedenken, dass die Ursachen von Femiziden „vielschichtig“ (254) sind, da unterschiedliche Formen der Diskriminierung von Frauen hierbei eine Rolle spielen. Nur vor diesem „komplexen Hintergrund“ (ebd.) sei das Phänomen Femizide umfassend zu verstehen. Tatsächlich sind die Ursachen von Femiziden noch um ein Vielfaches komplexer. Zwar bietet der Verweis auf patriarchal geprägte Machtverhältnisse Anhaltspunkte, warum Femizide als Phänomen in unserer Gesellschaft überhaupt existieren. Diese Verhältnisse können aber nicht vollständig erklären, warum bestimmte Personen Femizide begehen (oder Opfer eines Femizids werden). Daher sollten auch bekannte kriminologische Faktoren (z. B. psychische Erkrankungen und Suizidalität, Alkoholkonsum, soziale Deprivation) mitgedacht werden, statt, wie bisweilen in der Literatur feministische und kriminologische Ansätze zu unvereinbaren Gegensätzen zu stilisieren. Nur dann lassen sich Femizide wirklich umfassend verstehen.
Rechtliche Verarbeitung von Femiziden
Im Anschluss an die Diskussion des Begriffs Femizid geht der Monitor hauptsächlich auf die strafrechtliche Bewertung sogenannter Trennungstötungen[8] ein und bietet eine fundierte Darstellung der einschlägigen juristischen Literatur sowie Judikatur.
Insbesondere in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zu diesen Taten erkennt die BgG ein Problem für die Umsetzung der IK. Diese sieht in Art. 46 lit. a IK vor, dass es möglich sein muss, eine gegenwärtige oder frühere Partnerschaft zwischen Tatperson und Opfer strafschärfend zu berücksichtigen. Unter Verweis auf Teile der juristischen Literatur wird daraus der Schluss gezogen, dass die Norm jedenfalls einer strafmildernden Berücksichtigung einer (Ex-)Partnerschaft zwischen Tatperson und Opfer prinzipiell entgegenstehe. Gemessen daran stelle sich die Rechtsprechung des BGH zu Trennungstötungen als problematisch dar. Immer wieder werde das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe (§ 211 Abs. 2 StGB), das in diesen Fällen häufig den Unterschied mache zwischen Mord (§ 211 StGB) und Totschlag (§ 212 StGB), zu Unrecht verneint. Bis heute gebe es Entscheidungen, in denen eine vom Opfer ausgehende Trennung als Umstand herangezogen werde, der gegen die Niedrigkeit der Beweggründe spricht. Statt patriarchale Besitzansprüche zu erkennen, individualisierten die Gerichte die Taten, wenn sie in die Motivation des Täters Verzweiflung und Perspektivlosigkeit hineinlesen oder diese mit Blick auf vermeintlich „ambivalentes Opferverhalten“[9] (265) als menschlich nachvollziehbar einstufen.
Die Lage der obergerichtlichen Rechtsprechung ist in der Tat problematisch – und in Teilen konventionswidrig. So ist aktuell zwischen den Strafsenaten des BGH umstritten, ob an der überkommenen Rechtsprechung, dass eine opferseitige Trennung gegen niedrige Beweggründe spricht, festgehalten werden soll. Mit Blick auf Art. 46 lit. a IK sollte diese Frage eigentlich leicht zu beantworten sein. Allzu oft wird bei der Bewertung der Beweggründe zudem die Gewaltvorgeschichte in der Beziehung ausgeblendet!
Fraglich ist allerdings, ob das Problem tatsächlich in der Individualisierung der Tatmotivation liegt; ist es doch gerade Aufgabe der Gerichte, die (Höhe der) Strafe an der individuellen Schuld und nicht etwa an den strukturellen Ursachen einer Straftat zu messen. Außerdem handelt es sich bei der Gegenüberstellung von nur vermeintlicher Verzweiflung und tatsächlichen Besitzansprüchen um eine bisweilen unnötig zugespitzte, falsche Dichotomie. Männer, die nach einer Trennung ihre Ex-Partnerin töten, befinden sich nicht selten in einer von ihnen so empfundenen verzweifelten Lebenslage, und zwar häufig unter anderem deshalb, weil sie ihre (patriarchal untermauerten) Kontrollansprüche gegen das Opfer nicht mehr durchsetzen können. Die Lösung kann also nicht sein, den Tätern ihr subjektives Erleben abzusprechen, sondern dieses rechtlich korrekt einzuordnen.
Auch das oben genannte Problem, wie Motive überhaupt festzustellen sind, stellt in der Rechtsprechung eine erhebliche Hürde dar. Viele Landgerichte, die erstinstanzlich für Tötungsdelikte zuständig sind, erörtern nach unseren Erkenntnissen in ihren Urteilen noch nicht einmal, ob die Beweggründe des Täters niedrig waren. Wenn sie es tun, gelingt es den Gerichten häufig nicht, die Motive des Täters nachzuweisen und in so klare Worte zu fassen, dass eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen möglich wäre. Hilfreich erschiene es, die häufig gewaltvolle Vorgeschichte der Taten als objektiven Indikator für die (Niedrigkeit der) Beweggründe stärker zu betonen und den Zusammenhang zwischen „ambivalentem Opferverhalten“ und typischen Dynamiken in Gewaltbeziehungen bei der Bewertung der Beweggründe ausreichend zu berücksichtigen.
Im Übrigen sollte man sich mit moralisch aufgeladenen Rechtsbegriffen wie den „niedrigen Beweggründen“ auch aus feministischer Sicht nicht zufriedengeben. Was es braucht, ist letztlich eine umfassende Reform der Tötungsdelikte im StGB. Der Vorschlag der BgG, § 46 StGB (Grundlagen der Strafzumessung) noch einmal zu erweitern, dürfte demgegenüber kaum Auswirkungen auf die Anwendung des Mordparagrafen entfalten.
(Weitere) Empfehlungen
Grundsätzlich zu unterstützen ist die Empfehlung der BgG, das Angebot von Fortbildungen für die Strafverfolgungsbehörden auszubauen, da es unter Jurist*innen an Wissen über Dynamiken in Gewaltbeziehungen offensichtlich mangelt. Es stellt sich allerdings die Frage, wie zielführend es wäre, die qua Verfassung unabhängigen Richter*innen zu bestimmten Fortbildungen rechtlich zu verpflichten. Wünschenswert wäre indes eine stärkere Verankerung entsprechender Themen schon in der juristischen und polizeilichen Ausbildung.
Sinnvoll wäre es auch, wie von der BgG vorgeschlagen, weitere Forschung zu Femiziden zu finanzieren. Das Resümee der BgG, die statistische Erfassung von Femiziden sei primär von staatlicher Seite vorzunehmen, ist hingegen zu hinterfragen. Zwar ist es durchaus zutreffend, dass die PKS etwa um Variablen zur Gewaltvorgeschichte ergänzt werden könnte und sollte. Amtliche Kriminalstatistiken sind jedoch aus mehreren Gründen, etwa der dezentral organisierten Datenerhebung sowie datenschutzrechtlichen Hemmnissen, in ihrer Aussagekraft immer begrenzt. Um Femizide umfassend zu verstehen, ist feministisch informierte kriminologische Forschung unabdingbar, die sich nicht nur mit Femiziden, sondern auch mit anderen Formen der Tötungskriminalität eingehender auseinandersetzt. Eine Möglichkeit wäre, den European Homicide Monitor (EHM) in Deutschland umzusetzen, der in einigen europäischen Ländern bereits etabliert ist und aktuell in den Niederlanden und der Schweiz für die Erfassung von Femiziden fit gemacht wird.[10] Zugleich ist vermehrt qualitative Forschung notwendig, um sich den komplexen Ursachen von Femiziden anzunähern.
An dieser Stelle sei aus empirischer Sicht ein Umstand erwähnt, der in der Femizid-Debatte bisher kaum berücksichtigt wird: regelmäßig werden gerade in Trennungskontexten auch nicht-weibliche Personen viktimisiert. Häufig werden Kinder getötet, um die Ex-Partnerin zu bestrafen (indirekte oder stellvertretende Femizide). Aber auch neue Partner, Schwiegersöhne oder gar Zufallsopfer wie Nachbar*innen erfahren Gewalt durch Männer, die die Auflösung einer Intimbeziehung durch eine Frau nicht akzeptieren. Ein nächster Schritt müsste daher sein, die durch die Femizid-Debatte zurecht stark gemachte Geschlechterperspektive in der Betrachtung von Tötungsdelikten konsequent auszuweiten.[11]
Gewaltschutz
Das folgende Kapitel 6 enthält eine umfassende Darstellung der Vorgaben der IK für den Gewaltschutz sowie des deutschen Gewaltschutzsystems. Gewaltschutz bezeichnet in diesem Zusammenhang polizeiliche und gerichtliche Maßnahmen, um Personen insbesondere vor wiederholter häuslicher Gewalt zu schützen. Zu Recht weist die BgG darauf hin, dass der Gewaltschutz kriminalpräventiv von deutlich größerer Bedeutung ist als das Strafrecht, das bei geschlechtsbezogener Gewalt ohnehin chronisch zu spät kommt.