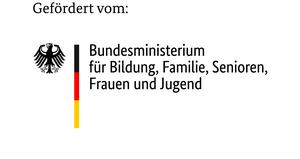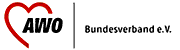Femizide sind in Deutschland kein Randphänomen, sondern die tödliche Spitze des großen Eisbergs geschlechtsspezifischer Gewalt – und zwei aktuelle Publikationen zeigen, wie groß der Handlungsbedarf ist: Die neue Studie „Femizide in Deutschland“ der Universität Tübingen und der Monitor „Im Fokus: Femizide in Deutschland“ der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt am Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR).
Für Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) machen beide Veröffentlichungen deutlich: Deutschland muss dingend nachbessern um den Schutz für Frauen zu verstärken– es braucht klare Definitionen, zuverlässigere Daten und konsequente Prävention, die bei Strukturen ansetzt.
Was die Studie des Instituts für Kriminologie und des Kriminologischen Forschungsinstituts zeigt
Das Forschungsprojekt „FemiziDE“ des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen und des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen hat Strafverfahrensakten zu fast allen 334 versuchten und vollendeten Tötungsdelikten mit mindestens einem weiblichen Opfer aus dem Jahr 2017 ausgewertet; nach Ausschluss von Fehlerfassungen blieben 292 Fälle, davon 197 versuchte oder vollendete Tötungsdelikte zulasten von Frauen, 133 wurden als Femizide im weiteren soziostrukturellen Sinn klassifiziert, 74 mit nachweisbar sexistischen Motiven.
Femizide werden zweistufig definiert: als vorsätzliche Tötungen von Frauen oder Mädchen, bei denen das Geschlecht des Opfers zentral ist – entweder durch explizit sexistisches Motiv oder durch strukturelle Verletzbarkeit in geschlechtstypischen Rollen wie Partnerschaft oder Betreuung.
Mit Abstand häufigste Form des Femizids ist der Partnerschaftsfemizid: 108 der 133 identifizierten Femizide ereigneten sich in oder nach einer heterosexuellen Partnerschaft, rund drei Viertel davon standen im Zusammenhang mit tatsächlicher oder befürchteter Trennung bzw. vermeintlicher Untreue (sog. De‑Etablierungsfemizide) mit gewaltgeprägter Vorgeschichte und sexistischen Rollenbildern des Täters.
Weitere Fallgruppen sind u. a. alters- und krankheitsbezogene Femizid‑Suizide, „Großmutterfemizide“, Sexualfemizide und misogyn‑psychotische Taten; als Risikofaktoren treten insbesondere sozioökonomische Benachteiligung und psychische Erkrankungen hervor.
Rolle von Frauenhäusern, Polizei und Prävention
Die Studie zeigt, dass die meisten Opfer von Partnerschaftsfemiziden vor der Tat weder Schutz in einem Frauenhaus gesucht noch Anzeige erstattet haben – häufig aus Angst vor weiterer Eskalation oder weil Anzeigen später zurückgenommen wurden. Wo Polizei und Justiz eingebunden waren, wurde das Eskalationspotenzial von Beziehungskonflikten unterschätzt, Schutzmaßnahmen zu früh aufgehoben oder durch Umgangsregelungen des Täters mit den Kindern unterlaufen; in drei Fällen verhinderte Platzmangel in Frauenhäusern den effektiven Schutz und 8,3 Prozent der Täter nutzten Kindesumgang, um Frauen zu töten.
Handlungsbedarf sehen die Forschenden insbesondere bei gewaltbegünstigenden Sozialisationsmustern von Männern, der besseren Unterstützung psychisch Erkrankter und sozial benachteiligter Menschen sowie bei gezielterer Schulung der Polizei zu Dynamiken und Gefährdungslagen in gewaltbelasteten Beziehungen. Hinzu kommen Vorschläge wie Reformen im Umgangsrecht, elektronische Fußfesseln in Hochrisikofällen und sogenannte Femicide Reviews, um Todesfälle systematisch auszuwerten und Schutzlücken zu schließen.
Was der Monitor des Deutschen Instituts für Menschenrechte leistet
Der Monitor „Im Fokus: Femizide in Deutschland“ der Berichterstattungsstelle geschlechtsspezifische Gewalt am DIMR bündelt erstmals systematisch Begriffsverständnis, Datenanalyse und menschenrechtliche Empfehlungen zu Femiziden im Lichte der Istanbul‑Konvention.
Er definiert Femizide als geschlechtsspezifische vorsätzliche Tötungen von Frauen und Mädchen, die von Rollenbildern, Stereotypen und Verhaltenserwartungen geprägt sind, die auf Ungleichwertigkeit beruhen, und unterscheidet Intimizide, familiäre Femizide sowie weitere Formen jenseits von Partnerschaft und Familie.
Besonders deutlich wird: Frauen und Mädchen werden vor allem im sozialen Nahraum getötet, während Männer überwiegend außerhalb von Ex‑Partnerschaft und Familie Opfer von Tötungsdelikten sind. Für das Jahr 2024 weist der Monitor 827 Frauen und Mädchen als Opfer versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte aus – im Schnitt mehr als zwei Opferwerdungen pro Tag; 300 Fälle gingen auf Ex‑Partner, 144 auf Familienangehörige zurück, weitere Kontexte wie Sexualmorde, Tötungen in Betreuungsverhältnissen und Hasskriminalität werden erstmals differenziert quantifiziert.
Datenlücken, Defizite, Empfehlungen
Der Bericht macht deutlich, dass es in Deutschland weder eine einheitliche Definition von Femiziden noch eine bundesweite Femizidstatistik gibt; zahlreiche Femizidformen – etwa „Ehrenmorde“, Tötungen von Sexarbeiterinnen oder Todesfälle nach unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen – werden statistisch nicht gesondert erfasst und bleiben unsichtbar. Diese Lücken erschweren eine angemessene Einordnung, verhindern zielgenaue Prävention und widersprechen den Datenerfordernissen der Istanbul‑Konvention.
Auch bei Prävention und Schutz zeigt der Monitor gravierende Defizite: Kampagnen adressieren Täter und geschlechtsspezifische Stereotype nur punktuell, Fortbildungen für Polizei und Justiz sind meist freiwillig, und es fehlt an verbindlichen Standards für Gefährdungsanalyse, Hochrisikomanagement und behördenübergreifende Überprüfung tödlicher Gewaltverläufe. Empfohlen werden u. a. eine bundesweite Femizidstatistik mit einheitlicher Definition, systematische Erfassung geschlechtsspezifischer Tatmotive, verbindliche Standards im Gefahrenmanagement, ein unabhängiger Überprüfungsmechanismus sowie massive Investitionen in Frauenhäuser, Fachberatung und verpflichtende Täterarbeit.
Einordnung aus Sicht von FHK
Für FHK zeigen Studie und Monitor übereinstimmend: Femizide sind Ausdruck struktureller Ungleichheit und eines unzureichenden Gewaltschutzsystems. Der Schutz vor tödlicher Partnerschaftsgewalt braucht verbindliche politische Antworten: ein bedarfsgerecht finanziertes Netz von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen, ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Gefährdungsmanagment in allen Bundesländern sowie ein interdisziplinäres Hochrisikomanagement, eine konsequente Ausrichtung von Sorge‑, Umgangs- und Aufenthaltsrecht am Gewaltschutz sowie eine klare politische Priorisierung von Prävention, Täterarbeit und Datenerhebung.